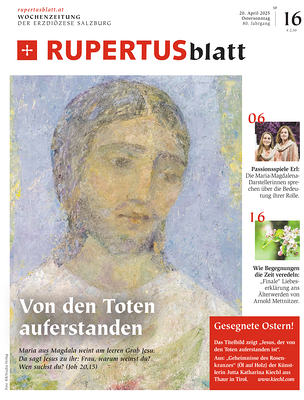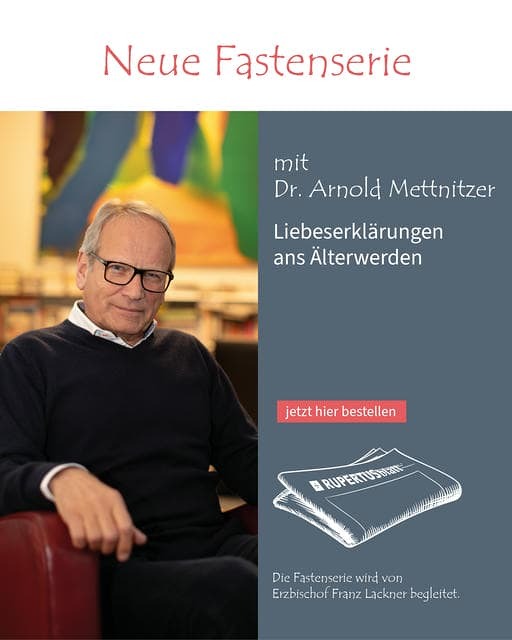„Gott teilt sich uns in Jesus Christus mit“

RB: Warum ist ein Konzil, das vor 1.700 Jahren stattgefunden hat, heute noch relevant? Welche theologischen Weichen in der Glaubensfrage wurden damals gestellt?
Dietmar W. Winkler: Hier ist das Große Glaubensbekenntnis grundgelegt worden. Es stellt unseren Glauben an die Dreifaltigkeit – die Trinität von Vater, Sohn und Heiliger Geist – dar und versucht, das damals viel diskutierte Verhältnis von Jesus Christus zu seinem Vater klarzustellen: dass er wahrer Gott und, wie später ausformuliert, auch wahrer Mensch ist.
RB: Eine Meinung, die nicht alle vertraten. Der Theologe Arius bezeichnete diese „Wesensgleichheit“ von Gottvater und Gottessohn als Irrlehre.
Winkler: Arius hat eigentlich Jesus sehr hoch eingeschätzt, wollte aber den Monotheismus retten. Und das hätte nicht funktioniert, wenn noch jemand dazukommt. Deshalb hat er eine Art Zwischenwesen kreiert. Für die Anhänger des Arianismus war Jesus nicht ganz Gott und nicht ganz Mensch: also mehr als jeder Mensch, aber weniger als Gott. Doch das war auch problematisch, weil Jesus damit eine Art Halbgott gewesen wäre.
RB: Es wurde also in Nizäa die Frage „Wer ist Jesus Christus“ verhandelt. Wie lässt sich das Bekenntnis, dass er „wesensgleich“ mit Gottvater war, Menschen mit weniger theologischem Wissen verständlich machen?
Winkler: Man muss zunächst zwischen „wesensgleich“ und „wesensähnlich“ unterscheiden. Das ist deshalb eine wichtige Abgrenzung, weil es in der Antike von wesensähnlichen Halbgöttern, wie den vielen Kindern des Zeus, nur so wimmelte.
Mit dem in Nizäa formulierten „wesensgleich“ wird ausgedrückt, dass Jesus Christus die engste denkbare Verbindung zu Gott gehabt hat und auf die Seite des Vaters gehört. Der Theologe Karl Rahner hat einmal gesagt: „Jesus war die letzte ultimative Selbstmitteilung Gottes.“ Und er meint „letzte“ dabei nicht zeitlich, sondern im Sinne von unüberbietbar. Das heißt: Jesus war ganz Mensch, aber er spricht in einer unüberbietbaren authentischen Weise. Durch diese Wesensgleichheit spricht er wie Gott. Die Worte die er spricht, sind Gottes Worte. Er ist Wort Gottes.
RB: Und wie würde man es, tiefer in die Begrifflichkeiten eintauchend, theologisch erklären?
Winkler: Gott tritt in Beziehung und ist selbst Beziehung. Er ist ein Beziehungsgeschehen, er ist Kommunikation und tritt mit uns in Kommunikation. Das ist ganz wesentlich für unseren Glauben. Gott teilt sich uns mit und wir können uns in der Liturgie, im Gebet auch Gott mitteilen. Dadurch haben wir ein Kommunikationsgeschehen – und ich finde das etwas ganz Großartiges. Das Christentum ist von allen Weltreligionen die einzige, die in einer solchen Weise ein dialogfähiges Gottesbild hervorgebracht hat. Gott spricht mit uns und tauscht sich mit uns aus. Gott ist nicht weit weg, er will ganz wesentlich mit uns zu tun haben und dringt sozusagen direkt in die Schöpfung ein. Das heißt es gibt eine ganz authentische Selbstmitteilung Gottes und Gott teilt sich uns in Jesus Christus mit.
Wir beten in der Liturgie – wie die vielen Christinnen und Christen vor uns – einen Text aus dem vierten Jahrhundert.
RB: Zurück zum Konzil von Nizäa: Wie bedeutsam ist das damals formulierte Glaubensbekenntnis?
Winkler: Das kürzeste Glaubensbekenntnis ist „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ Wenn aber jemand weiterfragt, wer der Vater sei, dann muss man das erklären und sagen: Der Vater ist der Pantokrator, der Schöpfer des Alls – wie es der erste Absatz des Großen Glaubensbekenntnisses von Nizäa beschreibt. Habe ich das definiert, stellt sich die Frage: Wer ist der Sohn? Um das ordentlich auszuformulieren, ist der zweite Absatz des Glaubensbekenntnisses etwas länger. Das alles hat nach wie vor Aktualität. Wir beten also in der Liturgie – wie die vielen Christinnen und Christen vor uns – heute noch einen Text aus dem vierten Jahrhundert. Das ist schon faszinierend. Nur beim Heiligen Geist wurde es später – beim Zweiten Ökumenischen Konzil im Jahr 381 – noch einmal ausformuliert.
RB: In heimischen Gottesdiensten beten wir ja das kürzere Apostolische Glaubensbekenntnis, nicht das längere Bekenntnis von Nizäa, das die Wesensgleichheit von Gottvater und Jesus Christus deutlicher betont. Wie schätzen Sie das heutige Verständnis von der Trinität/Dreifaltigkeit unter den Gläubigen ein?
Winkler: Ich denke, dass der eingangs erwähnte Arianismus auch im Denken von Menschen in unseren Pfarren nicht überwunden ist. Da gibt es zwei Ansätze. Die einen sagen, Jesus war ein ganz wunderbarer Mensch mit einer tollen Ethik und ist deshalb auch mit seinem Leben und in seinem ethischen Handeln für die anderen ein großes Vorbild. Andere sagen, er war zwar gottähnlich, eben weil er ein wunderbarer Mensch war, aber er war nicht ganz Gott. Das wäre im Prinzip eine Art Arianismus, der die intensive Gottesbeziehung Jesu Christi eben nicht ausdrückt.
RB: In der Kirchengeschichte gilt Nizäa als das erste ökumenische Konzil – mit einem verbindenden Bekenntnis für Katholiken, Protestanten und Orthodoxe. Wie hoch ist das einzuschätzen?
Winkler: „Oikumene“ heißt eigentlich „der bewohnte Erdkreis“, meinte damals aber das Römische Reich, es war also eine Reichssynode. Letztendlich wird ein Konzil aber durch Rezeption, also indem es angenommen wird, wirksam – und das geschah auch außerhalb des Römischen Reiches. Deshalb sind Nizäa und das darauffolgende Konzil in Konstantinopel (381), wo das Glaubensbekenntnis grundgelegt wurde, für die gesamte Christenheit relevant. Nizäa verbindet die christlichen Kirchen im Glauben an den Dreieinen Gott und an Jesus Christus.

Dietmar W. Winkler unterrichtet seit 2005 als Professor für Patristik und Kirchengeschichte in Salzburg und ist der Dekan der Theologischen Fakultät der Paris Lodron Universität Salzburg.
Teil 2 des Schwerpunkts ist demnächst der Bedeutung des Konzils von Nizäa für die Berechnung des Osterdatums gewidmet.