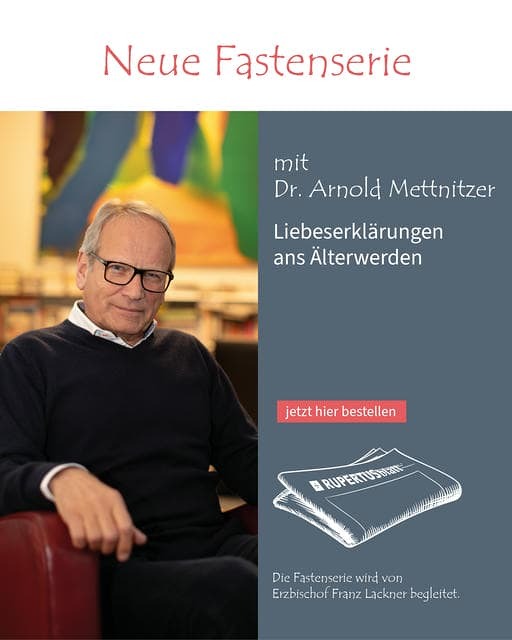„Ich möchte die Sehnsucht nach Gott wecken“

RB: In der Ukraine ist Frieden nicht in Sicht, genauso wenig wie in Israel und Palästina und in Artsach (Karabach) ist eine ganze Diözese untergegangen. Was hat 2023 Gutes gebracht?
Erzbischof Franz Lackner: Realismus ist angebracht. Wir müssen die Dinge, die uns bedrücken und bedrängen, benennen. Trotzdem verlieren wir als Christen nie die Hoffnung. Dort, wo Furchtbares passiert, können wir etwas tun, auch wenn es in einem Kriegsland vielleicht nicht direkt zu Frieden führen wird: Wir können den Geflüchteten helfen, wir können für den Frieden beten und uns so mit den Menschen verbunden wissen. Persönlich bin ich aber dankbar für das Jahr 2023. Ein Jahr Leben – das ist etwas Großes.
RB: Herr Erzbischof, Sie haben schon mehrmals unterstrichen, dass Papst Franziskus für Überraschungen gut ist. Kurz vor Weihnachten hat er den Weg für die Segnung homosexueller Paare freigemacht. War das für Sie eine Überraschung?
Erzbischof Lackner: Ja, ich war überrascht. Ich war selbst mehrmals in Rom in dieser Sache und finde es gut, dass die Erklärung „Fiducia supplicans“ („flehendes Vertrauen“) jetzt gekommen ist, gerade vor Weihnachten. Wir sollten Segen als ein Grundnahrungsmittel wie Brot wahrnehmen, wobei hier nicht von einem sakramentalen, „bestätigenden“ Segen die Rede ist. Die Ehe als Lebensgemeinschaft von Mann und Frau steht nicht zur Disposition. Hier geht es um einen bittenden, „aufsteigenden“ Segen, der das Gute festigen und mehren soll. Man reduziert nun vielleicht schnell auf die Form des Segens. Es geht aber um die innere Haltung: Da kommen Menschen und bitten um einen Segen. Dass wir grundsätzlich Nein sagen, ist mit diesem Schreiben nicht mehr möglich – Gutes sagen im Namen Gottes, das wollen wir niemandem verwehren. Ich habe schon vor der Entscheidung im Vatikan bei einem Gespräch mit der HOSI (Homosexuellen Initiative) gesagt: Ich trete für den Segen ein, bitte aber auch um Verständnis, dass eine Verwechslung mit der Eheschließung nicht geschehen darf.
Wir müssen Menschen, die in besonderen Situationen sind, weit entgegengehen.
RB: Was bedeutet die vatikanische Erlaubnis nun für die Erzdiözese?
Erzbischof Lackner: Es ist ein wichtiger Schritt, den Rom ge-
setzt hat. Er bedeutet: Wir gehen den Schritt zu den Menschen hin weiter. In der Erzdiözese werden wir diese Grundsatzentscheidung natürlich in den Gremien, im Konsistorium, im Pastoralrat und im Priesterrat besprechen. Dafür hatten wir noch nicht die Zeit. Für mich ist „Fiducia supplicans“ im Grunde die Fortschreibung des nachsynodalen apostolischen Schreibens Amoris laetitia („die Freude der Liebe“). Wir gehen Menschen, die in besonderen Situationen sind, als Kirche, als Gemeinschaft der Glaubenden, als Gemeinschaft der Getauften weit entgegen.
RB: Ein zentrales Ereignis 2023 war die Weltbischofssynode in Rom. Sie meinten danach: Ich habe persönlich viel gelernt.
Erzbischof Lackner: Ich bin zur Versammlung im Vatikan nach mehreren Etappen gefahren. Zu Beginn stand die diözesane Synodale Versammlung, dann die nationale sowie die kontinentale Ebene. Der bisherige Höhepunkt war der erste Teil der Weltsynode mit mehr als 350 Teilnehmenden. Die Wochen standen ganz im Zeichen des gemeinsamen Glaubens. Wir saßen an runden Tischen, jeweils zu zehnt oder zwölft zusammen, stets war jeder Erdteil vertreten und immer auch Laien und Frauen, nie nur Bischöfe. Das hat mich beeindruckt. Jeder und jede hat aus seiner und ihrer persönlichen Glaubenserfahrung- und Glaubensverantwortung gesprochen. Jeder Getaufte hat Verantwortung für den Glauben.

Ich habe aus meiner Erfahrung und Verantwortung als Erzbischof von Salzburg gesprochen. Wichtig war es, das Gesagte in den globalen Kontext zu setzen. Hier kommt die so genannte Indifferenz zum Tragen, der Abstand von der eigenen 100-prozentigen Antwort: Wie sehr will ich Recht haben? Ich muss zu mir, zu dem was ich gesagt habe, etwas auf Distanz gehen. Das Gesamte hat eine Ordnung, die das Meinige zurechtrückt. Ich habe diese Methode als sehr positiv empfunden.
RB: Sie sagten auch, Sie seien offener für mögliche Reformen zurückgekommen – für welche?
Erzbischof Lackner: Das sind etwa die vorhin angesprochenen Segnungen. Dafür bin ich eingetreten. Ein anderes ist das Thema der Diakoninnen. Das wird im Herbst bei der zweiten Weltversammlung eine konkrete Frage sein. Die Themen liegen am Tisch. Wir sind nun im Prozess des Weiterarbeitens, wir sind mittendrin. Nach der zweiten Versammlung im Herbst 2024 wird dem Papst der Abschlussbericht übergeben. Die letzte Entscheidung liegt bei ihm.
RB: Ist das beim Synodalen Prozess eingeübte Zuhören und „niemandem a priori die Wahrheit absprechen“ auch hilfreich in der Leitung der Diözese?
Erzbischof Lackner: Selbstverständlich. Bei Visitationen wende ich die Methode des „geistlichen Gesprächs“ an. Zuhören, aus dem Herzen sprechen und Gebet. Im Glaubensleben geht es sehr oft um das ehrliche Bemühen. Wir brauchen das Bemühen, dass es ein geistlicher Prozess bleibt, dass der entscheidende Impuls von außen kommen kann. Ein Platz muss für den Heiligen Geist freibleiben. Die Diskussion bekommt dadurch eine andere Qualität.
Ich möchte ein Beispiel bringen. Die Schwestern auf der Kinderalm haben nach dieser Methode ihre Statuten, die das geistliche Zusammenleben regeln, neu aufgestellt. Früher war es so, dass ein ausgewählter Kreis, die Leitung des Klosters und die Zuständigen der Diözese, diese bestimmten. Dieses Mal wurden alle Schwestern einbezogen. Ich habe eine Schwester am Ende gefragt: „Ist das, was du gesagt hast, berücksichtigt worden?“ Sie antwortete: „Nein – aber es ist verwandelt übernommen worden.“ Der Heilige Geist sei manchmal die dritte Option. Das finde ich eine schöne Beschreibung.
RB: Im Jänner sind Sie zehn Jahre Erzbischof von Salzburg. Wie blicken Sie auf diese Zeit?
Erzbischof Lackner: Mit großer Dankbarkeit. Es ist natürlich nicht immer einfach in unserer Zeit ein solches Amt auszuführen. Oft ist es schwer zu argumentieren, dass Glaube eine Institution braucht. Sie ist das Gerippe, ohne es wäre das Herz ungeschützt. Insgesamt überwiegen aber die Freude und das Wissen: Ich bin gesendet. Ich habe es gewissermaßen nicht „von meiner eigenen Festplatte heruntergeladen“, dass ich Erzbischof bin. Ich habe es wirklich als eine Sendung empfunden. Anfangs war es schwer – nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Ich komme aus einer Keuschlerfamilie – mein Vater wollte Maurer werden und durfte nicht. Und dachte: Jetzt bist du Erzbischof? Schön ist es aber, wenn ich erlebe, wie sich die Menschen zum Beispiel in den Pfarren freuen, wenn ich mit ihnen Gottesdienst feiere und zu und vor allem mit ihnen spreche. Der Glaube hat etwas zu geben – dem möchte ich dienen.
Was würde uns fehlen, wenn es diese Kirche nicht mehr gibt?
RB: Was sind die größten Herausforderungen für die Erzdiözese Salzburg derzeit: der Priestermangel, Kirchenaustritte, die weniger werdenden finanziellen Ressourcen, der Bedeutungsverlust der Kirche?
Erzbischof Lackner: Das sind alles Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen. Eine andere aber, die nur wenig angesprochen wird, beschäftigt mich sehr: Der Auferstehungsglaube schwindet. Wie können die Menschen Sinn am Leben auch in den schwersten Stunden sehen? Es gibt so etwas wie eine letzte Gerechtigkeit. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Es gibt Auferstehung. In der Offenbarung des Johannes steht: „Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal.“ Unser Glaube ist ein Hoffnungsglaube – selbst in den fürchterlichsten Lebenssituationen. Dafür gibt es aber in unserer Zeit fast kein Gespür. Ich möchte die Sehnsucht im Menschen nach Gott wecken.
Die Menschen sagen oft, es fehle etwas. Gott müsse in dieses Fehlen hineinpassen. Doch so ist Gott nicht. Gott ist kein Lückenbüßer, Gott wird Mensch. Aber nicht nur, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern er gibt dem Leben einen neuen, ursprünglichen und über die Zeiten hinaus geltenden Sinn. Ich glaube nicht, weil ich muss, sondern weil Glauben an sich schön ist. Ich glaube, weil ich glaube. Es gibt keine Alternative. Diese Dimension fehlt mir auf weiten Strecken. Wir sind heute sehr menschenzentriert. Das ist an sich nicht unwichtig – doch Gott als Gott verdient unsere höchste Aufmerksamkeit.
RB: 2024 stehen im Vatikan zwei Großereignisse an. Die Weltsynode geht in die entscheidende Phase und am 24. Dezember 2024 läutet der Papst mit der Eröffnung der Heiligen Pforte am Petersdom das Heilige Jahr ein.
Erzbischof Lackner: Die Weltsynode beschäftigt uns 2024 noch einmal intensiv. Und das beginnende Heilige Jahr ist eine gute Gelegenheit darüber nachzudenken, was Heiligkeit im 21. Jahrhundert bedeutet. In unserer Diözese kommt der Organisationsentwicklungsprozess in die Umsetzung. Die Zentrale wird neu aufgestellt. Dazu gehört auch, dass wir schlanker werden und Synergien noch mehr nützen müssen. Wie allen Institutionen machen uns die Inflation, die Kostenteuerung und das Zinsverhalten zu schaffen.
Eine Frage treibt mich bei all dem um: Was ist der USP (Unique Selling Proposition), das Alleinstellungsmerkmal der Kirche? Was würde fehlen, wenn es diese Kirche nicht gibt? Ich glaube, es würde gesellschaftlich etwas fehlen. Unser Glaube ist lebensdienlich, ein Glaube, der uns hilft, Hürden und Schwierigkeiten zu überwinden und der Hoffnung zu geben vermag. In diesem Sinne müssen wir als Kirche bei den Menschen sein, hinhören und mit ihnen im Gespräch bleiben.
RB: Haben Sie persönlich Vorsätze für das neue Jahr gefasst?
Erzbischof Lackner: Leider halte ich meine Vorsätze immer zu wenig ein. Ich gehe auf die 70 zu. Gelassener und ruhiger zu werden wäre ein altersgemäßes Verhalten. Aber am wichtigsten ist mir das Gebet. Dafür möchte ich mir bewusst Zeit nehmen.