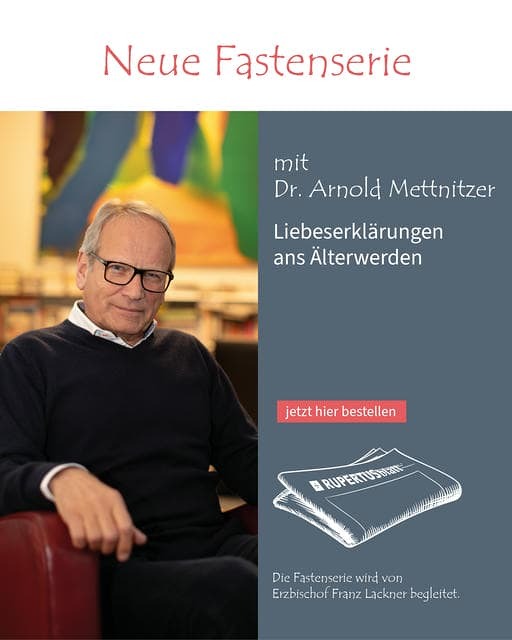Wie lernen wir morgen?

Wenn es um die Schule und das Lernen in der Zukunft geht, schwenkt der innere Blick bei vielen von uns vom Overhead-Projektor über das Tablet hin zur VR-Brille, die den Träger eine virtuelle Umgebung erleben lässt. Für Zukunftsforscher Tristan Horx ist die Technik jedoch nur ein winziger Aspekt im großen Thema „Bildung von morgen“ (siehe unten). Denn die Tatsache, dass Wissen heute jederzeit und überall abgerufen werden kann, verändert unsere Bildung von Grund auf – und wirft drängende Fragen zum veralteten Schulsystem auf: Welche Kompetenzen müssen die Lehrpersonen der Zukunft selbst mitbringen und welche müssen sie bei ihren Schülerinnen und Schülern bilden und fördern?
Zuallererst sollten wir uns vom „aristokratischen Denken“ lösen und sechs Jahre Grundschule für alle anbieten, plädiert Horx für eine „6+5-Jahre-Struktur“. Zudem sollten wir früh die Neigungen der Kinder mit individualisierten Lerninhalten in Modulsystemen fördern. Es sei uninteressant, ob Lehrpersonen schneller und besser rechnen können – Pädagoginnen und Pädagogen müssten zukünftig vermehrt „Lebenspraxis und Soft Skills“ in den Unterricht mitbringen, so Horx.
Und die ältere Generation, die sich bereits auf lebenslanges Lernen eingestellt hat? „Die demographische Lage ist extrem ernst – die Wirtschaft wird dazu gezwungen werden, die vielen wertvollen Fähigkeiten der älteren Menschen zu nützen“, zeigt sich Tristan Horx optimistisch. Weil das Abstellgleis keine Option ist.
agenda 2030
Was versteht man unter globalem Lernen? Seit der Entwicklung des Internets ist „die Welt ein Dorf“ geworden. Aber bedeuten mehr verfügbare Informationen gleichzeitig auch, dass wir Zusammenhänge verstehen und kritisch reflektieren können? Nicht zwingend. Deshalb ist es das Ziel des „Globalen Lernens“ im Sinn der Bildungsagenda 2030 der UNO, ökonomische, soziale, politische, ökologische und kulturelle Entwicklungen als Prozesse wahrzunehmen, die man mitgestalten kann. Das Bildungskonzept lehrt und gibt Orientierung in großen Zusammenhängen unserer vernetzten Weltgesellschaft. Infos: bildung2030.at
für sie gelesen
Empathie und Selbstführung: Das druckfrische Praxisbuch für Lehrende betrachtet Schule aus einer gesunden Distanz: Welche Rolle nimmt eine Lehrkraft im 21. Jahrhundert ein? Betrachtungen rund um die Schlüsselkompetenzen Empathie und Selbstführung und wie der praktische Zugang zum Engagement für positive Veränderung gelingen kann, finden sich in diesem eben erschienenen Buch. – Kathrin Höckel: Schule von morgen. Ein Trainingsbuch für die Lehrkraft der Zukunft (Verlag utb).
Kompetenzen: „Vorbereitung auf die Gesellschaft“
Individualisiertes Lernen ist für viele zukunftsweisend. Wie ist es umzusetzen?
Wir haben noch immer das habsburgische Bildungssystem, hier gibt es eine riesige Verzögerung im Schulbetrieb. Individualisierte Lerninhalte kann man (in verschiedenen Modulen aufgeteilt) in spezialisierten Klassen weitergeben.
„Wissen ist Macht“ – gilt das noch immer?
Nein, das war einmal! Wissen ist vielerorts verfügbar. Schule ist nicht mehr das Vermitteln von Inhalten, sondern die Vorbereitung auf die Gesellschaft. Von den Lehrpersonen sind daher mehr „Soft Skills“ gefragt, also soziale Kompetenzen, mit denen wir mehr Humanes reinbringen. Es geht um selektive Information, abgestimmt auf die Kinder.
Stichwort „Lebenslanges Lernen“: Was erwartet uns noch in puncto Bildung?
Es wäre spannend, wenn es mehr Grauhaarige auf den Unis geben würde. Die Wirtschaft sollte die vielen Fähigkeiten älterer Menschen nützen – sie wird es ohnehin bald müssen.

Tristan Horx, Zukunftsforscher, Buchautor und Trendanalyst (Zukunftsinstitut Horx, Wien).