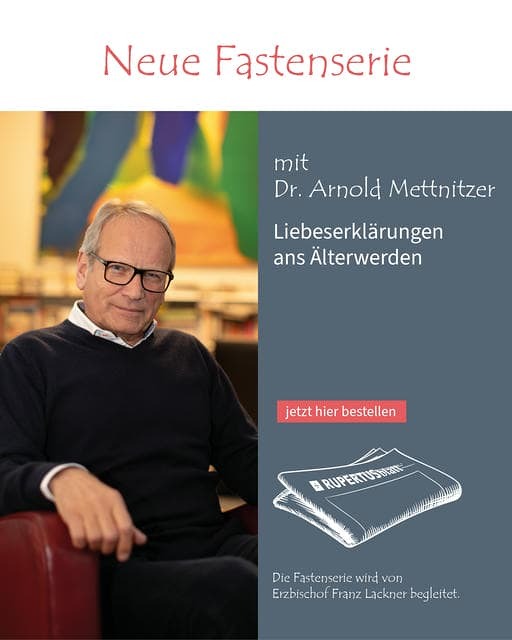Doppeltes Jubiläum für das „vierte“ Domkapitel

Salzburg. Mithin jährt sich 2025 das zweihundertjährige Bestehen des (vierten) Salzburger Domkapitels, aber auch die Erstnennung der (ersten) Domkanoniker vor 1.100 Jahren. (Peter F. Kramml).
Eine Kanonikergemeinschaft steht am Beginn
Die Erwähnung von weltgeistlichen Kanonikern reicht in Salzburg bis in die Zeit Bischof Virgils im Jahr 748 zurück. 925 wird dann zum ersten Mal ein Salzburger Domkapitel urkundlich erwähnt. Ein Domdekan findet sich erstmals 931. Nach der Trennung der Erzdiözese Salzburg vom Stift St. Peter konnte sich das Domkapitel eigenständig entwickeln.
Vom Chorherrenstift zum „weltlichen“ Adelsinstitut
Erzbischof Konrad I. verwandelte die bisherige Gemeinschaft 1122 in ein reguliertes Chorherrenstift. Die Kanoniker lebten nach den Bestimmungen des heiligen Augustinus. 1514 wurde dieses Kloster säkularisiert.
Das nunmehrige dritte Domkapitel war jetzt ein weltgeistliches Domkapitel für 24 Adelige, die in verschiedenen Häusern lebten und nicht ständig in Salzburg anwesend waren. Seit dem 12. Jahrhundert wurde das Domkapitel mehr und mehr zum alleinigen Wahlgremium für den Salzburger Erzbischof. Deshalb entstammten auch die meisten Erzbischöfe Salzburgs bis ins 20. Jahrhundert dem Domkapitel. Zudem übten die Domkapitulare wichtige Leitungsfunktionen im Erzstift aus und regierten das Land in den Phasen zwischen Tod und Neuwahl eines Erzbischofs. Die Domherrenstellen mit ihren lukrativen Einkünften waren eine gute Versorgungsmöglichkeit für Söhne des katholischen Adels. Eine Priesterweihe war dafür nicht notwendig.
Diese Phase des dritten Domkapitels endete mit der Säkularisation des Domkapitels. Mit 1. Jänner 1807 wurden sämtliche Güter des Domkapitels dem Staat einverleibt. Alleine im Kaiviertel verfügte das Kapitel neben anderen Gebäuden über 18 Kanonikalhöfe. Das Kapitel war seiner weltlichen Güter beraubt. Aber kirchenrechtlich wurde es formell nie aufgehoben.
Die Wiedererrichtung des Domkapitels 1825
Zwischen Ende 1800 und 1824 wohnte in Salzburg kein Erzbischof. In dieser bischofslosen Zeit gab es ab 1807 Überlegungen für eine Wiederbelebung des Domkapitels. 1817 regelte ein kaiserliches Dekret zumindest theoretisch die Dotierung des Erzbischofs und des Domkapitels samt seiner zukünftigen Verfasstheit. Große Verdienste um die Wiedererrichtung kommen hier Erzbischof Augustin Gruber zu, der 1824 in sein Amt als Erzbischof eingeführt worden ist. Nach Abschluss der langen Verhandlungen ernannte Kaiser Franz I. im Jänner 1825 die neuen Domkapitulare. Die am 7. März 1825 verabschiedete Bulle „Ubi primum“ von Papst Leo XII. bestätigte im Wesentlichen die staatlichen Regelungen. Das Domkapitel bestand aus zwölf Kanonikern, für die eine Priesterweihe, aber nicht mehr die Adelszugehörigkeit gefordert war. Zusätzlich gab es zwei „Domizellarkanonikate“ für junge Adelige. Am 25. März 1825 erfolgte bei einem Festgottesdienst die Einsetzung des neuen Domkapitels im Dom.
Das Kapitelkreuz kommt mit Verspätung
Am 25. März 1827 genehmigte der Kaiser ein eigenes Kapitelkreuz. Auf der Vorderseite zeigt es den heiligen Rupertus. Rückwärts finden sich die Initialen F.1 für Kaiser Franz I. mit der Jahreszahl 1825. Der Vorschlag, auch die Initialen des Erzbischofs „A.1.“ für Augustin I. anzubringen, kam leider zu spät: Die Produktion der Kreuze hatte bereits begonnen.
Das Salzburger Domkapitel feiert Geburtstag
Am Fest der Domkirchweihe, dem 25. September 2025, wird das Jubiläum mit einem Gottesdienst im Dom gefeiert. Es erscheint zudem die Publikation „200 Jahre erneuertes Domkapitel“.

Autor Roland Kerschbaum ist seit zwölf Jahren Domkapitular sowie zudem Diözesankonservator, Pfarrer von Elsbethen und Salzburg-Aigen.