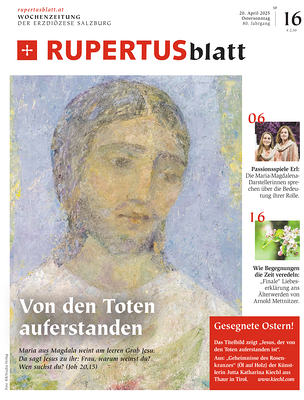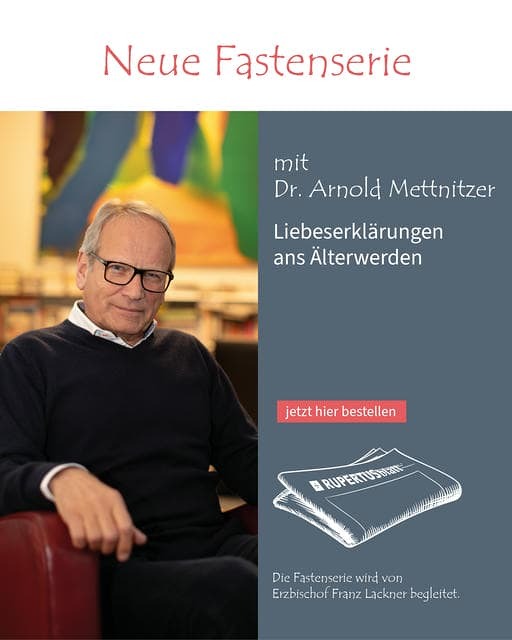Leben und Sterben in Würde: Palliativpflege

Bischofshofen. Die medizinische Versorgung mit Symptomkontrolle und Schmerzlinderung, die fachliche Begleitung der Pflege, die psychische, soziale, zum Teil auch organisatorische Unterstützung – rund um die Palliativbegleitung von Menschen, die schwer erkrankt sind oder sich im Sterbeprozess befinden, stellen sich viele Aufgaben. Mit zwei großen Zielen: Leid und Schmerzen der Betroffenen zu lindern und trotz aller Einschränkungen noch ein lebenswertes Dasein zu ermöglichen. „Das ist es, was wir in erster Linie erreichen wollen“, sagt die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Katharina Löcker, die das mobile Palliativteam der Caritas in Bischofshofen im Pongau leitet.
Schicksale machen betroffen
Krankheit und Tod gehören dementsprechend zum Alltag der 37-Jährigen, auch wenn die Arbeit wohl nie „alltäglich“ wird. Braucht man für diesen wertvollen Dienst an anderen Menschen umgangssprachlich ausgedrückt ein dickes Fell? „Natürlich versucht man, eine professionelle Distanz zu wahren und das Leid nicht zu nahe an sich heranzulassen. Das gelingt mal mehr, mal weniger und darf auf jeden Fall nicht in Gefühlskälte ausarten“, beschreibt Löcker das herausfordernde Arbeitsumfeld und verrät, was ihr dann doch immer wieder an die Nieren geht: „Wenn ich jemanden von früher persönlich kenne oder wenn vergleichsweise junge Menschen – zum Teil in meinem Alter – betroffen sind, die vielleicht gerade eine Familie gründen, ein Haus bauen und kleine Kinder haben. Solche Schicksalsschläge machen betroffen.“
Mehr als 100 Personen werden im Pongau pro Jahr vom siebenköpfigen mobilen Palliativteam der Caritas betreut. Dafür verfügen die fünf Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, eine Sozialarbeiterin und eine Medizinerin über fundierte Fachausbildungen. Bei starken Schmerzen kann rasch medizinische Erstversorgung geleistet werden. Die Sozialberatung unterstützt bei Bedarf bei Behördenwegen, etwa zum Thema Familienhospizkarenz, sowie bei der Beschaffung von Hilfsmitteln – vom Pflegebett bis zum Leibstuhl. Kosten entstehen für Betroffene oder Angehörige übrigens keine. Zu beachten ist nur, dass die mobile Palliativbegleitung in der gewohnten Umgebung kein Ersatz, sondern eine Ergänzung zu Hauskrankenpflege und hausärztlicher Versorgung ist.
Keine Scheu vor erstem Anruf
Begleitet werden überwiegend Krebspatienten, hinzu kommen neurodegenerative Erkrankungen oder auch Lungen- und Herzerkrankungen im Endstadium. „Es braucht keine Zuweisung, nur das Einverständnis der Betroffenen. Zumeist wenden sich ja die Angehörigen an uns“, beschreibt Löcker den niederschwelligen Erstkontakt und bedauert ein wenig die Scheu der Menschen: „Viele finden den Weg erst spät oder gar nicht zu uns, weil sie bei Palliativmedizin und Hospiz gleich Bilder vom Sterben und der Bestattung statt Schmerzlinderung und Verbesserung der Lebensqualität vor Augen haben. Mein Ratschlag lautet: Ein Anruf ist schnell gemacht. Wenn man das Gefühl hat ,Vielleicht sollte ich das mal probieren‘, dann ist genau der richtige Zeitpunkt, um bei uns anzurufen.“