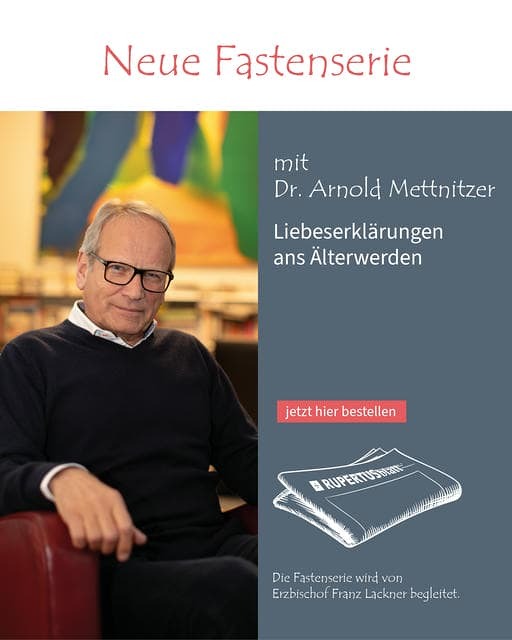Unsterblich durch Technik?

Die Vorstellung von der Unsterblichkeit der menschlichen Seele gehört in vielen religiösen Traditionen zum Glaubensbestand. Die Frage nach der Unsterblichkeit wird jedoch auch in anderen Zusammenhängen gestellt. So wird in Bereichen der Technik und der Wissenschaft – ermöglicht durch den technologischen Fortschritt – versucht, den physischen Tod zu überwinden, um in gewisser Weise ebenso eine Form von Unsterblichkeit zu erreichen.
Ein Ziel des Transhumanismus ist es, das menschliche Bewusstsein zu digitalisieren und in eine künstliche Umgebung zu übertragen.
Der Transhumanismus ist ein Beispiel dafür und bezeichnet eine Bewegung, welche die biologischen Grenzen des Menschen durch den Einsatz von Technologien erweitern will. Kernthemen des transhumanistischen Denkens sind: die Lebensverlängerung, das Ziel der Unsterblichkeit und die Optimierung des Menschen – das alles mithilfe neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz oder Innovationen aus Biotechnologie und Nanotechnologie. Zudem ist es ein Ziel, das menschliche Bewusstsein zu digitalisieren und in eine künstliche Umgebung zu übertragen. Während manche dieses Bestreben als die nächste Stufe der Evolution ansehen, warnen Kritikerinnen und Kritiker vor den damit zusammenhängenden ethischen und gesellschaftlichen Folgen: Wird der Mensch durch Technik wirklich unsterblich – oder nur abhängiger von Technik und Maschinen?
Streben nach Verbesserung
Dass Menschen danach streben, sich selbst zu verbessern, ist kein neues Phänomen. Neu ist jedoch, dass heute die technologischen Möglichkeiten ausgefeilter und weiter entwickelt sind als jemals zuvor. Vom Einsatz künstlicher Gelenke bis hin zur Veränderung von Erbanlagen findet auf vielfältige Weise bereits eine „technische Veränderung“ des Menschen statt. Im Zuge dessen können auch Beeinträchtigungen beseitigt sowie der körperliche Verfall hinausgezögert werden.
Die Idee des Transhumanismus wirft neben theologischen auch tiefgreifende ethische und soziale Fragen auf, die weit über technische und wissenschaftliche Überlegungen hinausgehen und die Grundlagen des Menschseins betreffen. Ein Kritikpunkt betrifft die Gefahr, dass Menschen gezwungen werden könnten, sich den Technologien und Entwicklungen zu unterwerfen, um in einer zunehmend technologisierten Welt konkurrenzfähig bleiben zu können. Und auch der Aspekt der (globalen) Gerechtigkeit spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle: Wenn die Möglichkeit der technischen Weiterentwicklung und Optimierung mit Kosten verbunden ist, muss die Frage gestellt werden, ob diese Form des „Fortschritts“ dann wirklich für alle Menschen möglich ist? Oder nur für jene, die sich dies auch leisten können – und wollen.
Robert Wurzrainer ist Referent für Weltanschauungsfragen der Erzdiözese Wien.