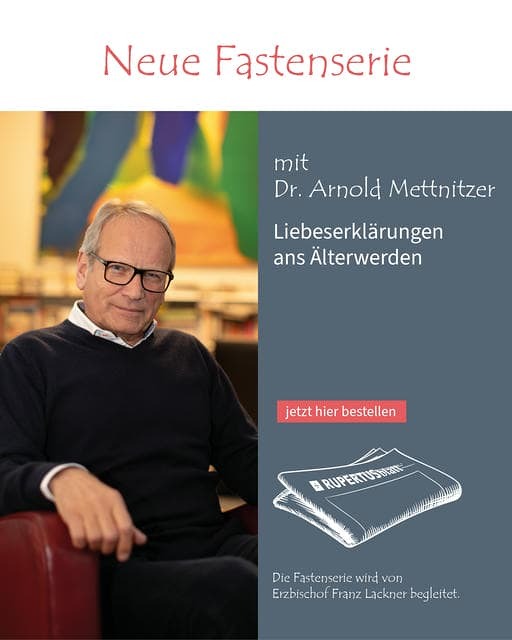Aktuelles E-Paper
Mit Essen und Bibel in den Luftschutzkeller

E s ist Elias Zorns erster Besuch in der Ukraine. Und das, während die Medien russische Vorstöße in der Ostukraine melden. Das Ziel des Jus-Studenten ist Lwiw (Lemberg) im Westen des Landes, das von Wien etwa gleich weit entfernt liegt wie Vorarlberg.
Die Anreise in Zeiten des Krieges ist kompliziert. Mehr als 20 Stunden ist Elias Zorn aus Salzburg mit Bahn und Bus unterwegs. Sein Aufenthalt in der von k.-k.-Architektur geprägten Stadt Lemberg wird dann nicht länger dauern als die lange Hin- und Rückfahrt. Doch er hat ein Ziel für das sich die Reisestrapazen lohnen: Als Vertreter der Katholischen Hochschuljugend Österreichs nimmt er an der 95-Jahr-Feier der ukrainischen katholischen Studentenbewegung „Obnowa“ teil. Zurzeit sind es mehr Studentinnen als Studenten, die sich bei Obnowa engagieren. Eine davon ist die 24-jährige Studentin der Internationalen Entwicklung, Nadiia Shchurko.
Ich kenne Familien, die seit drei Jahren keine Nachricht über einen Verwandten haben – Vater, Bruder, Sohn oder Tochter.
Ich bete, dass er noch lebt
„Wir leben in einer geschichtsträchtigen Zeit“, reflektiert die junge Frau. „Die ukrainischen Studierenden spüren das. Wir schreiben Geschichte.“ Das lassen sich die Menschen viel kosten, manche sogar das Leben. „Wir spüren, dass die Ukraine als Staat verloren ist, wenn wir das nicht tun“, gibt die Studentin mit den freundlichen Augen und der Brille auf der Nase zu bedenken. „Ohne diesen Krieg könnten auch die ukrainischen Burschen studieren, reisen oder an Konferenzen teilnehmen. Dass ihnen das nicht möglich ist, ist unfair.“ Von ihrem guten Freund, der wie sie an der Ukrainischen Katholischen Universität in Lwiw studiert hat, hat Nadiia seit drei Wochen keine Nachricht mehr bekommen. „Ich weiß, dass er vor zwei Wochen einen Militäreinsatz hatte, aber er hatte mir versprochen, sich danach wieder zu melden.“ Dass sie in großer Sorge um ihn ist, ist nachvollziehbar. „Ich bete wirklich, dass er noch lebt. Ich bete viel. Wenn die Soldaten einen Einsatz haben, können sie ihr Handy nicht mitnehmen, um Nachrichten zu schreiben. Dann kann ich nur beten und warten.“
Manchmal schicken auch Kameraden Informationen über eine Person. Wenn die Nachrichten abreißen, gelten die Soldatinnen und Soldaten als vermisst. Das kann Jahre dauern, weiß Shchurko. „Ich kenne Familien, die seit drei Jahren keine Nachricht haben über einen Verwandten – Vater, Bruder, Sohn oder Tochter.“

Täglich um 9 Uhr schweigen
Ob sie selbst auch überlegt habe, Soldatin zu werden, will Elias Zorn wissen. „Ich hatte nur kurze Momente, in denen ich darüber nachgedacht habe“, erklärt die Studentin. „Und zwar, als ich besonders wütend darüber war, welche Verbrechen in den russisch besetzten Gebieten begangen werden: Vergewaltigungen von Frauen und sogar Kindern. Oder wie sie mit den Gefangenen umgehen! Wenn du das siehst, hast du das Gefühl, etwas dagegen tun zu müssen.“ Dennoch meint sie, dass sie „zu feig“ ist für das Leben als Soldatin.
„Ich kann der Ukraine aber auch auf andere Weise helfen“, weiß sie. Jeden Sonntag um zwölf Uhr beteiligt sie sich an Demonstrationen, die an die Kriegsgefangenen erinnern. Und täglich um 9 Uhr in der Früh gibt es in der ganzen Ukraine eine Schweigeminute. „Egal, wo du bist, bleibst du stehen und schweigst. Es ist wichtig für uns.“ In der Anfangszeit der russischen Invasion brachte die Studentenbewegung „Obnowa“ zudem gemeinsam mit einer Schweizer Bruderschaft humanitäre Güter in besonders betroffene Gebiete wie Cherson.
Stress durch fehlenden Schlaf
Die ersten Monate nach Beginn der großen Invasion waren besonders anstrengend, erinnert sich Nadiia Shchurko. Sie war gerade dabei, ihre Bachelor-Arbeit zu schreiben. Doch dann begannen die Luftangriffe und die Alarme. „Jede Nacht mussten wir um zwei oder drei in der Früh in den Luftschutzkeller gehen.“ Ein Rucksack mit den wichtigsten Dingen stand immer fertig gepackt neben der Eingangstür bereit. Dokumente, Wasser, Essen und die Bibel waren bei Nadiia Shchurko immer dabei. Außerdem Schlafsack, Unterlegsmatte und Zahnpasta.
„Manchmal sind wir direkt aus dem Luftschutzkeller zur Uni gegangen.“ Stress hat ihr nicht nur der fehlende Schlaf bereitet („Studierende schlafen überhaupt wenig, aber zu Friedenszeiten vielleicht wegen der Partys. In der Ukraine schlafen sie momentan wegen der Angriffe wenig“), sondern auch das Risiko, dass der Alarm losgehen könnte, während sie gerade shampooniert in der Dusche steht. Das ist ihr aber nur einmal passiert, und sie schaffte es nur mit nassen Haaren rechtzeitig in den Luftschutzkeller.
Mittlerweile gehört der Krieg zum Alltag. Das heißt nicht, dass er nicht mehr bedrohlich ist, aber man hat sich daran gewöhnt.

Hoffnung: frei und sicher
„Wir erkennen die Geräusche von Drohnen oder verschiedenen Raketen-Arten. Viele Studierende legen sich im Luftschutzkeller schlafen. Man kann nicht produktiv sein ohne Schlaf. Wir haben uns abgewöhnt, zu vorsichtig zu sein. Ich kann die Rakete ja nicht aufhalten.“
Was sich Nadiia Shchurko nicht abgewöhnt hat, ist das Gefühl der Mitverantwortung für das, was passiert. Darum kehrte sie auch gerne wieder aus ihrem Auslandsstudienjahr in Barcelona nach Lwiw zurück. „Ich bin dankbar für das Jahr im Ausland, habe dort Freunde aus verschiedenen Ländern gewonnen. Aber zurzeit ist mir mein Land wichtiger. Wenn ich mich jetzt nicht dafür einsetze, kann es sein, dass ich eines Tages keine Heimat mehr habe. Ich möchte meinen Kindern einmal erzählen können, dass ich alles dafür getan habe, dass unser Land frei und sicher ist.“
Monika Slouk/ibu