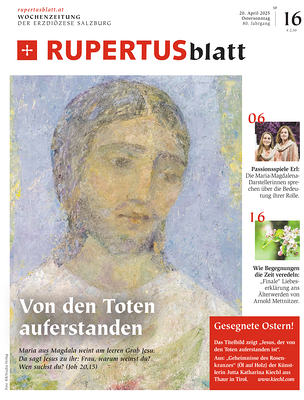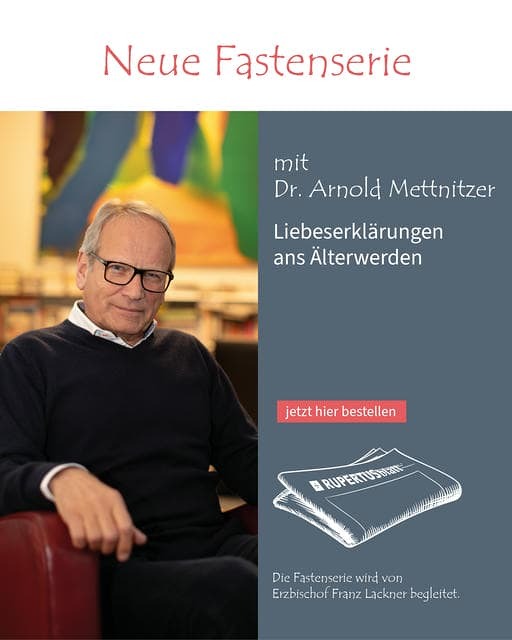Heiliger des Menschlichen

Die Freude ist groß. Ich beschäftige mich doch schon seit einigen Jahren mit Engelbert Kolland, sagt Br. Gottfried Egger OFM. Der Franziskaner spielt auf die Heiligsprechung an, bei der er live in Rom dabei ist. Und noch rechtzeitig ist eine Neuauflage seines Buches über den bedeutenden Zillertaler erschienen. Im Gespräch berichtet der Engelbert-Kolland-Experte wie er den neuen Heiligen sieht und warum er ein wahrer „Franziskussohn“ ist.
RB: Welche Bedeutung hat die Heiligsprechung von Engelbert Kolland?
Br. Gottfried Egger OFM: Mit der Heiligsprechung ist Engelbert nicht mehr „nur“ ein Seliger der Erzdiözese Salzburg. Er ist jetzt ein Heiliger der Weltkirche. Wir Franziskaner sind ein Weltorden und es ist schön, dass er nun in der ganzen Welt als Heiliger verehrt wird.
RB: Wie würden Sie seine Heiligkeit beschreiben?
Br. Gottfried Egger: Engelbert war ein tiefreligiöser Mensch, der sich selbstlos für seine Mitmenschen hingegeben hat. Ich würde zudem sagen, seine „Werktagsheiligkeit“ zeichnet ihn aus. Das zeigt sich darin, dass er mit einer großen Treue und Liebe Dinge im Alltag vollbracht hat. Anders ausgedrückt: Das Gewöhnliche hat er gut getan. Für mich ist er ein menschlicher Heiliger. Er steht nicht irgendwo auf einem Podest. Er kommt uns durch sein Verhalten sehr nahe.
RB: Haben Sie ein Beispiel für das „Er hat das Gewöhnliche gut getan“`?
Br. Gottfried Egger: Er hat sich alle Mühe gegeben in Damaskus zu den Menschen zu gehen, mit ihnen zu essen oder Hochzeiten zu feiern. Er hat sich unter die Menschen gemischt, um sie noch besser kennen zu lernen. Er ist ja nicht unbedingt umfassend vorbereitet worden für diese Mission. Es war schon ein Kulturschock für ihn. Alles war neu und fremd. Doch immer ist seine Liebe zu den Menschen zu spüren.
Als sich die Christenverfolgung im Juli 1860 zuspitzte, verließen alle das Kloster. Einzig die drei Maroniten und die rund 100 Klosterschüler blieben mit den Franziskanern. Die Kinder hörten die Menschen draußen schreien. Das verängstigte sie sehr. Es heißt, Engelbert hätte die weinenden Kinder auf eine sichere Terrasse geleitet. Er brachte ihnen frisches Brot. Es war dieses typische arabische Fladenbrot, von dem er sogar seiner Familie nach Hause geschrieben hat, er hätte nie ein besseres Brot gegessen. Er gibt den Buben davon zu essen, um sie so zu beruhigen. Das war ein zwischenmenschlicher Akt der Herzlichkeit und Liebe.
RB: Sie wenden sich in Ihrem Buch mit einem Brief an Engelbert Kolland. Sie schreiben: „Du bist ein wirklich überzeugender Franziskussohn!“ Was machte ihn dazu?
Br. Gottfried Egger: Er war authentisch. Er hat die Menschen, mit denen er gelebt und gearbeitet hat, geliebt. Dazu fällt mir eine Episode ein, die ebenfalls in einem Brief beschrieben ist. Es war damals Brauch, dass jeder Missionar einen Bart getragen hat. Engelberts Bart war rot wie Feuer. Für orientalische Menschen war er eine auffällige Erscheinung. Als er an einer Frau auf der Straße vorbeigegangen ist, sagte diese zu ihrer Gefährtin: „Gott bewahre uns vor diesem roten Teufel.“ Engelbert hörte diese Worte. Geistliche waren Respektpersonen. Er hätte die Frauen ermahnen können. Doch das tat er nicht. Er hat nur gelacht und ist weitergegangen.
Natürlich war er nicht nicht mit allem einverstanden. Manchmal hat er selbst kräftige Ausdrücke gebraucht, wenn er Situationen geschildert hat. Doch gerade das ist das Menschliche an ihm. Es waren herausfordernde Zeiten. Engelbert ist in ein völlig fremdes Land gegangen. Er hatte zudem einen unsicheren Status. Eines Tages kam ein Mitbruder in Damaskus an und Engelbert dachte, er muss jetzt zusammenpacken und das Kloster verlassen. Es war aber letztlich niemand da, der die Sprache besser beherrschte und ihn ersetzen konnte. So hat er seine Position als „Provisorischer“ halten können.
All diese Herausforderungen in Damaskus hätte er wahrscheinlich nicht gemeistert, wenn er nicht tief im Gebet verbunden gewesen wäre.Er war ein sehr frommer Mann.
RB: Engelbert Kollands Leben war von Beginn an nicht ohne Hürden: Seine Eltern waren so genannte „Inklinanten“ („Evangelische“), er hatte Schwierigkeiten in seiner Schul- und Studienzeit. Wie haben diese „Kämpfe“ Engelbert Kolland geprägt?
Br. Gottfried Egger: Die „Inklinanten“ wurden auf Befehl des Kaisers Ferdinand II. aus Tirol 1837 vertrieben. Vater Kolland wollte nach München ziehen, bekam aber keinen Pass dafür. Stattdessen wanderten er und seine Familie nach Rachau in die Steiermark aus. Der freundliche Fürst-Erzbischof Schwarzenberg machte Kajetan Kolland das Angebot, seine Söhne Florian und Michael (spätere P. Engelbert) am k.k. Gymnasium in Salzburg studieren zu lassen. Vater Kolland stimmte dem zu, was doch eine gewisse Weite zeigt, dass er diese Bildung seinen Söhnen nicht vorenthalten wollte.
Engelberts Schullaufbahn gestaltete sich jedoch holprig. Er hat das erste Jahr nicht bestanden. Er ist also ein Heiliger, der im Leben seine Schwierigkeiten hatte. Es ist nicht alles geradlinig gelaufen.
Sein späteres Studium hat er zunächst abgebrochen. Er suchte dann als Holzarbeiter sein Auskommen. Das war sicher eine harte Schule: vom Studenten plötzlich zum Holzfäller. Wenngleich das wahrscheinlich eine wichtige Erfahrung für ihn war. Er hat dann auch erkannt, „das ist nicht mein Weg“. Engelbert kam zurück nach Salzburg und der Regens nahm ihn wieder auf. Und schließlich erreichte er doch noch einen Abschluss mit guten Noten. Später entwickelte er sich in der Mission zu einem Sprachengenie. Bereits nach gut zwei Monaten hat er das Evangelium in Arabisch verkündet. Er beherrschte das Hoch- und das Volksarabische. Er konnte sich mit den Menschen gut verständigen.
RB: Die Lage der Christen in der damaligen Zeit war sehr angespannt. Bis heute nimmt die Anzahl und Bedeutung der Christen im Nahen Osten kontinuierlich ab.
Br. Gottfried Egger: Das Leben für Christinnen und Christen im Nahen Osten ist alles andere als einfach. Die Heiligsprechung kann ihnen ein Stück weit Mut machen und ihnen sagen: Haltet durch.
RB: Sie waren vor Jahren in Damaskus am Ort von Engelberts Wirken Wie haben Sie das erlebt?
Br. Gottfried Egger: Es war beeindruckend. Meine Besuche 2003 und 2008 fanden jedoch vor dem Bürgerkrieg statt. Die aktuelle Situation kenne ich nicht genau.
Ich erinnere mich an die Gastfreundschaft und dass wir den Sonntagsgottesdienst schon morgens um sieben gefeiert haben. Es waren vor allem ältere Menschen anwesend. In Damaskus ist die Mehrheit der Bevölkerung muslimisch. Die meisten Christen gehen daher erst Sonntagabend in die Kirche. Tagsüber müssen sie arbeiten. Offizieller Feiertag ist ja der Freitag. Ich habe dann gestaunt, wie viele am Abend zum Gottesdienst kamen: Kinder, junge Familien, alle Generationen waren versammelt. Ich dachte, da lebt der Geist von „Abouna Malak“ weiter. So wurde Engelbert genannt. Übersetzt heißt das „Vater Engel“. Das passt: Er war wirklich ein Engel für die Menschen.