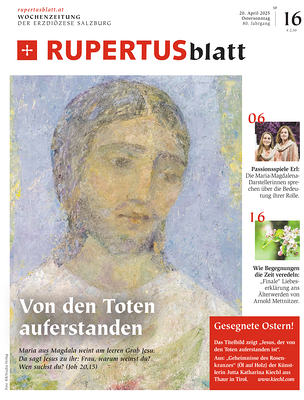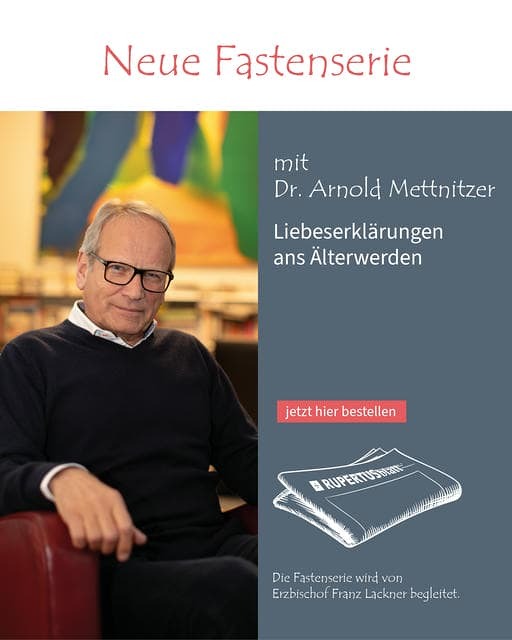Kommt irgendwann ein gemeinsames Osterdatum?

Das Ringen um einen gemeinsamen Ostertermin für die Ost- und Westkirche ist jahrhundertealt und beileibe keine Randnotiz im Christentum. Auch das Ökumenische Konzil von Nizäa, dessen 1.700-Jahr-Jubiläum wir heuer begehen, nahm sich des Themas an – und brachte scheinbar eine Lösung: Ostern sei am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond zu feiern. Doch die Umsetzung scheiterte an vielen Faktoren: unterschiedliche Berechnungen und Kalender (julianisch und gregorianisch) sowie abweichende Interpretationen astronomischer, biblischer und historischer Daten, aber auch divergierende theologische Ansätze.
Christliche Kernbotschaft
Gute Gründe für eine Einigung gibt es viele. „Über das Osterfest-Datum wurde bereits vor dem Konzil von Nizäa diskutiert, weil der Tod und die Auferstehung Jesu Christi den Kern der christlichen Botschaft ausmachen. Das Thema war also immer relevant und man wollte das Osterfest genau zum richtigen Termin feiern, um möglichst nah am Ursprung zu sein“, erklärt Dietmar W. Winkler, Dekan der Theologischen Fakultät der Universität Salzburg, zum Osterzyklus als zentralem Bestandteil des liturgischen Jahres. Vor allem die katholische Kirche sucht nach Kompromissen, bis hin zur Übernahme des julianischen Kalenders.
Zweiter Sonntag im April
An Bemühungen mangelt es nach wie vor nicht. Frank Walz, Assistenzprofessor für Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie in Salzburg führt aus: „Schon lange versucht man die Ostertermine der christlichen Kirchen zu vereinheitlichen. Der Ökumenische Patriarch Bartholomaios spricht 2024 von einem ,Skandal, das einzigartige Ereignis der Auferstehung des einen Herrn getrennt zu feiern‘ und Papst Franziskus regte bereits 2015 ganz konkret einen Fixtermin für Ostern an, etwa am zweiten Sonntag im April.“
Es wäre ein wunderbares Zeugnis, wenn wir Christinnen und Christen zu diesem wichtigen Fest immer gemeinsam in der Welt auftreten.
Diesem Datum kann auch Hansjörg Hofer, Weihbischof der Erzdiözese Salzburg, viel abgewinnen: „Es wäre abseits der praktischen Überlegungen ein wunderbares Zeugnis, wenn wir Christinnen und Christen zu diesem wichtigen Fest immer gemeinsam in der Welt auftreten. Dass wir zusammen und nicht getrennt feiern.“
Bert Groen, Professor für Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie i.R. der Uni Graz, nennt die Bemühungen bei einem Vortrag an der Theologischen Fakultät der Uni Salzburg „höchst komplex und vielstimmig“ und sagt im Geiste der Ökumene: „Viele haben aufgegeben ... trotzdem kann die Suche nach einem gemeinsam gefeierten Osterdatum als zentrales Bindeglied zur ersehnten kirchlichen Einheit beitragen und den innerchristlichen Zusammenhalt fördern.“
Nicht alle ziehen mit
Hindernisse auf dem Weg zum gemeinsamen Ostern sind unbestritten. „Für manche, wie etwa die slawische Orthodoxie, ist der Termin ihres Osterfestes auch ein wichtiges Identitätsmerkmal – und sie wollen keine Änderung“, sagt Groen und relativiert: „Ein gemeinsames Osterdatum ist wichtig, aber es ist nicht das Allerwichtigste. Das sind Gerechtigkeit, Liebe, eine funktionierende, wahrhaft synodale Kirche und wahrhaft ökumenische Beziehungen.“
teilnehmen
In Salzburg werden als Zeichen der Verbundenheit am Karsamstag um 18.30 Uhr die ökumenische Osternacht vor Maria Plain und am Ostermontag um 18 Uhr eine ökumenische Ostervesper im Dom gefeiert.